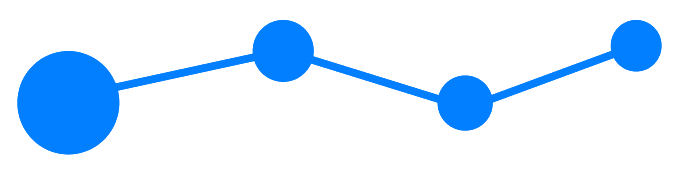Diese Podcastfolge zeigt Herstellern, wie sie ihre Geräte IoT-fähig machen können und produzierenden Betrieben, wie sie mithilfe einer IoT-Waage ihr Teilemanagement optimieren können. Die HK.SYSTEMS GmbH, Partner für digitale Geschäftsmodelle und den schnellen, effektiven Einstieg in die Digitalisierung, hat in Folge 63 des IoT Use Case Podcasts zwei Tochterfirmen mitgebracht – HELICOM und ROBIOTIC – um die Lösungen dafür vorzustellen.
Zusammenfassung der Podcastfolge
Viele Hersteller von Geräten, industrieller Automatisierung oder Komponenten gehen heutzutage den Weg, die Daten aus der Hardware für Kunden nutzbar zu machen und neue Services zu entwickeln! Warum? Bislang hat der klassische Hardwarevertrieb diese in großer Stückzahl verkauft – so das Kerngeschäft – doch heute wollen Endkunden die Daten aus den Geräten und Komponenten mehr und mehr einsetzen und in ihre Prozesse integrieren – das fordert neue Kompetenzen und digitale Lösungen.
Genau diese neuen Geschäftsmodelle und Services werden in dieser Folge am Beispiel von drei realisierten Use Cases vorgestellt: unter anderem einem Use Case mit der Firma WÜRTH – dem Spezialisten für Montage- und Befestigungsmaterial – mit der Gesellschaft Würth Industrie Service GmbH & Co. KG und einem Use Case aus dem Bereich der „Gefahrstoffe“ (DENIOS).
Es wird gezeigt, worauf es für Kunden hier ankommt, welche Geschäftsmodelle sich ergeben, und wie man es schafft, in sechs Wochen zum ersten IoT-Produkt zukommen.
Die Themen und Kompetenzen auf einen Blick:
• Schnelligkeit der Umsetzung: von der Idee bis zum Funktionsmuster in 6 Wochen
• Entwicklungskompetenz von der Hardware bis zum Betrieb der Lösung
• Autarke und flexible Lösung durch Mobilfunkübertragung OHNE Involvierung der lokalen IT (z.B. WLAN)
• Lange Laufzeit durch Nutzung von NB-IoT Funkstandard und intelligenter Algorithmik der Übertragung
Madeleine Mickeleits Podcastgäste in Folge 63:
- Sven Ehrmann (CEO & Head of Digital Business, HK. SYSTEMS)
- Thomas Krekeler (Geschäftsführer, ROBIOTIC GmbH)
- Viktor Giesbrecht (Firmenleitung, HELICOM)
Podcast Interview
Sven, ich glaube, viele IoT-Projekte befinden sich noch ganz am Anfang. Es gibt die Proof-of-Concepts, die gestartet sind, aber viele Projekte scheitern immer noch – oder es gibt zumindest Herausforderungen, sagen wir mal so. Was sind aus deiner Sicht die Top-3-Gründe, warum Digitalisierungsprojekte heute scheitern?
Sven
Vielen Dank für die wirklich gute Frage, Madeleine. Das Spannende ist, dass sich das über die letzten Jahre gar nicht so sehr verändert hat. Ich beschäftige mich selber schon seit knapp 20 Jahren mit digitalen Geschäftsmodellen und M2M- und IoT-Themen. Und die größte Herausforderung, die nach wie vor besteht, ist – das werden sehr, sehr viele Kunden gerade aus dem deutschen Mittelstand kennen: Know-how und Ressourcen.
Habe ich denn wirklich im eigenen Unternehmen genug Know-how? Mitarbeiter, die sich mit digitalen Themen in der Tiefe auskennen, sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite? Und habe ich auch genug Ressourcen, die solche Projekte tatsächlich durchziehen können? Das ist etwas, worüber wir sehr viele Gespräche in unserem Kundenklientel führen und wo wir natürlich auch ein guter Partner sind, um dort zur Seite zu stehen und unterstützen zu können.
Der zweite Punkt ist das ganze Thema der Schnittstellen-Koordination. Wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Themen, die in einem IoT-Projekt zu realisieren sind. Das fängt an mit den IoT-Devices, also der Hardware. Es geht über die Datenübertragung, sprich Konnektivität. Wir haben das ganze Thema des Daten-Handlings in der Cloud – wie gehe ich mit diesen Daten um? Wie gebe ich die auch wieder aus? … Ich habe Schnittstellen zu eigenen Systemen oder vielleicht sogar zu eigenen Applikationen, und ich muss das betreiben. Ich brauche Service dafür. Und nicht zu vergessen am Ende des Tages: natürlich auch die IT-Security, die immens wichtig ist, um sicher unterwegs zu sein.
Und selbst wenn ich Spezialisten in einzelnen Bereichen habe – die Koordination dieser Schnittstellen ist eine große Herausforderung und frisst häufig in den Projekten unglaublich viel Zeit. Das führt mich auch schon zum dritten Grund: Die Angst vor dem Scheitern. Was wir immer wieder merken, ist, sobald es vor allem schwierig wird in Form von, es dauert länger als ursprünglich angenommen, dann werden Projekte im Digitalisierungsumfeld häufig schon kritisch betrachtet, manchmal sogar praktisch eingestellt. Gar nicht etwa, weil sie auf dem falschen Weg gewesen wären. Sondern weil es einfach Hürden zwischendrin gibt, die an der Stelle schwierig werden. Die darauf hindeuten, dass es deutlich länger geht. Und da ist es wichtig, sich von Anfang an einfach klarzumachen, wie kann ich diese Schnittstellen perfekt koordinieren, oder bestmöglich koordinieren, um nicht unnötig Zeit zu verbrauchen? Aber auch den Mut zu haben, wenn es schwierig wird, über diese Hürde drüberzugehen und dann die nächsten Schritte erfolgreich in Angriff zu nehmen.
Den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen – klar, es bedarf neuer Skillsets und entsprechenden Know-hows. Aber ich glaube, diese Lernkurven kann man auch gemeinsam nehmen, gemeinsam angehen. Deswegen lernen wir in der IoT-Community auch supergerne von vorhandenen Projekten – Use Cases, wie wir das nennen. Um einfach mal zu wissen, wie machen das andere? Welche Erfahrungswerte kann ich da nutzen? Wie dealen andere mit diesen Herausforderungen? Welche Use Cases aus der Praxis habt ihr mitgebracht? In einen davon würde ich auch gerne im Detail eintauchen, um das Projekt zu verstehen.
Sven
Zum einen haben wir heute ein Projekt mitgebracht, das wir die letzten Monate mit der Würth Industrie Service – das ist eine Gesellschaft aus dem Würth-Konzern – erfolgreich umgesetzt haben. Jetzt sind wir in der Serie und unterstützen die Würth Industrie Service da, wo sie ihre Dienstleistung beim Kunden im Industriebetrieb optimieren und damit auf dem Markt noch erfolgreicher sein können.
Thomas, Viktor, ihr habt mit unterschiedlichsten Kunden zu tun – habt ihr zum Einstieg noch ein Beispiel, um zu verstehen, wo ihr außerdem noch unterwegs seid?
Thomas
Einer unserer spannendsten Kunden ist die DENIOS SE. DENIOS ist Weltmarktführer als Equipmentlieferant für die Lagerung von Schad- und Gefahrstoffen. Das heißt, in jedem Industriebetrieb wird es Produkte von DENIOS geben. Sie haben 16 000 Katalogprodukte, liefern aber auch große Raumsysteme – wirklich geschmiedete Kammern, die auf Sattelschleppern dann zu Industriekunden gefahren werden, wo Gefahrstoffe aufbewahrt werden. Sie sind dort schon viele Jahre am Markt und weltweit tätig. Spannend bei diesem Kunden ist, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren und uns als verlängerte Werkbank für das digitale Business ins Boot geholt haben. DENIOS ist sehr innovativ und auch innovationsgetrieben. Sie wollen also das Business auf andere Rollen und Beine stellen. Wir liefern hier nicht nur Hardware, die wir gemeinsam mit ihnen entwickeln, wo also die Kompetenz von Viktor und seiner Mannschaft einfließt – die also Daten von A nach B liefern. Sondern wir liefern hier das komplette Cloudsystem, aber auch die Applikation hintendran, die die Prozesse rund um das Thema Gefahrstoff-Handling auslöst. Das heißt, bislang hat DENIOS reine Hardware verkauft – jetzt verkaufen sie das gute Gefühl von Sicherheit. Weil nämlich die Prozesse rund um das Thema Hardware nun digitalisiert sind.
Also quasi ein neues Geschäftsmodell für DENIOS an der Stelle
Thomas
Ganz genau, völlig neues Geschäftsmodell. Eine sehr kundenbindungsintensive Applikation, die sie da mitliefern. Also zu dem Leckage-Sensor jetzt auch noch die automatisierten Prozesse.
Dann haben wir also ein Projekt, was ihr im Bereich Logistik habt, mit Würth zusammen. Dann jetzt den Teil Gefahrstoffe mit DENIOS. Viktor, hast du noch ein drittes Projekt, anhand dessen wir verstehen, wo ihr noch unterwegs seid?
Viktor
Ja, wir haben noch einen ganz besonderen Use Case, und das ist unser Alarmierungs-Pager. Das ist zunächst ein ganz klassischer Feuerwehr-Pager, wie man ihn so kennt und worüber die Einsatzkräfte alarmiert werden. Das Besondere an diesem Pager ist, wir nutzen redundante, permanente, bidirektionale, sparsame, verschlüsselte Datenverbindungen – über die öffentlichen Mobilfunknetze. Das heißt, wir bauen ständig eine Datenverbindung auf, zu jedem dieser GSM-Technik-basierten Pager. Somit haben wir die Möglichkeit, auch verschiedene Mobilfunktechniken zu nutzen oder über mehrere Provider zu roamen. Und durch diese ständige Verbindung weiß das System vor beziehungsweise während des Alarmbeginns, welche dieser Einsatzkräfte überhaupt verfügbar oder erreichbar sind. Dieser Pager wird eingesetzt bei Bergsfeuerwehren zum Beispiel oder Staffel- oder Feuerwehren, die über Landes- oder Bundesgrenzen hinaus arbeiten.
Das Thema Brandschutz ist ja immer noch eines der relevantesten. Ich glaube, da gibt es viel Potenzial in Richtung IoT und neue Logiken, die man einbringen kann. Ich würde die Projekte in den Shownotes verlinken. Springen wir in das erste Projekt, das Sven vorgestellt hat, mit der Firma Würth. Du hast schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht tauchen wir einfach mal in den täglichen Job eures Endkunden ein. Was hat Würth hier für Aufgaben? Kannst du uns in das Projekt reinzoomen?
Sven
Ich denke, jeder der Zuhörer wird schon mal in irgendeiner Weise gehört, gesehen oder vielleicht sogar mit Würth zusammengearbeitet haben – als weltgrößter C-Teile-Lieferant, den es gibt. Unser Kunde hier ist speziell die Würth Industrie Service, das heißt, der Arm der Würth-Gruppe, der tatsächlich Industrieunternehmen mit C-Teilen versorgt und mit dem Management und der Logistik von C-Teilen. Um das ein bisschen einzuordnen: C-Teile hört sich immer ein bisschen nach kleinteilig und nicht so wichtig an. Der erste Part stimmt noch – kleinteilig ist sicher nicht verkehrt. Aber enorm wichtig für die Produktion und die Sicherheit, dass die Produktion auch weiterlaufen kann. Denn wenn C-Teile fehlen, sprich, Schrauben, andere Kleinteile, dann kann das tatsächlich zu Produktionsausfall führen. Das heißt, Verfügbarkeit und auch die Passgenauigkeit von der Verfügbarkeit – also Lieferfähigkeit – ist ein enorm wichtiges Thema. Und die Würth geht hier den Schritt, diesen kompletten Service für die Kunden zu übernehmen, und sicherzustellen und zu garantieren, dass immer genug Teile in der Produktion vorhanden sind – in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität und auch zur richtigen Zeit nachgeliefert werden. Gerade das ist eine große Herausforderung, weil natürlich nicht permanent jemand nebendran steht von Würth, und schaut, wann ist denn der Kanban-Behälter, in dem die C-Teile abgefüllt werden, das nächste Mal wieder leer? Das heißt, ich habe einen logistischen Aufwand, um sicherzustellen, dass immer etwas da ist. Und diesen kompletten Prozess haben wir mit Würth, mit IoT-Technologie, tatsächlich deutlich vereinfacht und nebenher auch noch deutlich Platz in den Produktionsstätten gespart und damit wieder zur Verfügung gestellt.
Das heißt, Würth hat hier auch eine Art neues Geschäftsmodell aufgebaut? Bislang liefert man C-Teile – und jetzt stellt man plötzlich den Kontakt zum Endkunden her, und weiß, wie geht es meinen C-Teilen … muss da was nachgeliefert werden und so weiter?
Sven
Es ist zum Teil ein neues Geschäftsmodell. Um aber fair zu bleiben: Diesen Service hat Würth schon in der Vergangenheit angeboten. Sicherlich nicht immer; aber das ist Teil des Würth-Geschäftsmodelles. Nur eben mit einem hohen logistischen Aufwand – und diesen Prozess konnten wir deutlich vereinfachen. Letztendlich gehört dieses Kanban-System, das beim Kunden in der Produktion, am Montageplatz steht, auch nicht dem Endkunden – der kauft das nicht. Sondern er bekommt diesen Service von Würth, die darauf entsprechend ihr Geschäftsmodell ausgelegt haben.
Quasi ein intelligenterer Service, der nun an dieser Stelle weiter ausgebaut wird?
Sven
Korrekt.
Herausforderungen, Potenziale und Status quo – So sieht der Use Case in der Praxis aus
Thomas, wenn wir noch mal an den Anfang zurückgehen: Viele sind vielleicht noch gar nicht da, wo Würth heute ist. Trotzdem würde ich mal so ein bisschen die Herausforderung von Würth herausstellen, wie man so ein Projekt startet. Was sind die Potenziale, die sie gesehen haben? Womit sind sie am Anfang gestartet?
Thomas
Sven hat es schon angedeutet: Ein hoher logistischer Aufwand und ein hoher personeller Aufwand für Würth, der diesen Service ja prinzipiell schon in der Vergangenheit angeboten hat. Die Challenge, diesen Prozess zu digitalisieren, war, eine Hardware zu finden, die einmal das Thema Wiegen übernimmt, kompatibel ist zu bereits bestehenden Kanban-Behältern. Das heißt, perfekt angepasst an das System, das sie vor Ort ausgerollt haben. Und die Sicherstellung, dass die Systeme, die dann ausgerollt werden, Plug-and-Play-funktionabel sind. Das heißt, die müssen wirklich beim Kunden aufgestellt und eingeschaltet werden und funktionieren. Sie müssen auch von der Datenverbindung her immer verfügbar sein – denn das System funktioniert natürlich nur dann, wenn man sich auf die Hardware verlassen kann.
Das ist auch Teil von Viktors Aufgabe gewesen, eine Funkverbindung zu schaffen, die datensparsam arbeitet, aber auch gut erreichbar ist in Umgebungen, die vielleicht mit normalem Mobilfunk nicht erreichbar sind. Da nutzen wir die Narrow-Band-IoT-Technologie.
Das war die Herausforderung bei Würth und da konnten wir sie sehr gut unterstützen.
Also erst mal eine eher technologische Herausforderung, aber durchaus mit einem Business Case dahinter – dass es Einsparpotenziale und Personalaufwand gibt. Es gibt einen großen Beschaffungsaufwand, den man hier versucht hat, zu digitalisieren beziehungsweise zu vereinfachen, um am Ende Geld zu sparen und auf beiden Seiten den Geschäfts-Impact herauszustellen. Zum Thema Wiegen, Sven, kannst du uns ein bisschen abholen: Viele sind schon technisch affin und mögen es, über die Praxis zu sprechen. Welche Daten sind hier besonders spannend? Nicht auf Bits und Bytes gerichtet, sondern die Arten von Daten. Das Gewicht? Oder was brauche ich hier für Daten?
Sven
Das ist eine superspannende Frage, und die Antwort hört sich erst mal ganz banal an: Das Wichtigste ist tatsächlich das Gewicht. Das heißt, wir wiegen die Kanban-Box, inklusive den Inhalt, und wissen dadurch, wie viel Inhalt ist in dieser Box noch enthalten? Jetzt muss man wissen, dass natürlich – kann sich jeder sicherlich gut vorstellen – jedes einzelne Teile ein eigenes Gewicht hat. Es gibt unterschiedlich große Schrauben, unterschiedliche Befestigungsteile wiegen etwas anders. Die Herausforderung, der wir uns gestellt haben, ist, dass wir nicht nur Daten empfangen können – das heißt, das Kanban-Behältnis, die IoT-Waage sendet nicht nur Daten, sondern kann aus dem ERP-System von Würth tatsächlich auch Konfigurationsdaten zurückspielen. Das heißt, je nachdem, was in diesen Kanban-Behälter hineinkommt, weiß das System über die Gewichtsmessung, wie schnell leert sich das und wann muss ich nachliefern? – Für den optimalen Zeitpunkt brauche ich nur noch diesen einen Behälter, der mit der Waage ausgestattet ist, und kann damit den kompletten Service abbilden.
Klingt erst mal relativ trivial, zu wiegen, aber da steckt wahrscheinlich eine ganze Menge Analytics dahinter. Viktor, eine technische Frage in deine Richtung: Der Kunde hat ja immer verschiedenste Anforderungen. Was war DENIOS wichtig für die Auslegung der Hardware? Da gibt es wahrscheinlich viele Dinge zu beachten, oder?
Viktor
Richtig. Zunächst die raue Industrieumgebung, die der Kunde bei solcher C-Teile-Lieferung und solchen Einsatzorten hat. Das fordert auch die Gehäuse und die Elektronik heraus. Dann war auch eine ganz bestimmte Plug-and-Play-Technik beim Kunden gegeben – das heißt, maximal Stromversorgung dran, und dann soll alles laufen. Des Weiteren die autarke Stromversorgung. Das heißt, hier musste ein Batteriebetrieb her – es sollte kein Netzteil irgendwo installiert werden zum Beispiel. Dann sollte der nachgelagerte Prozess, die Nachlieferung, selbständig ablaufen. Das heißt, es sollte kein händischer Eingriff sein. Diese ganzen Prozesse sollten automatisch laufen. Es sollte auch kein lokales WLAN oder sonstige Netze benutzt werden – sie wollten sehr netzUNabhängig sein. Der nächste Punkt war, einen globalen Einsatz zu ermöglichen. Sie liefern diese Kanban-Boxen ja weltweit aus und so wollten sie auch die Waagen gerne weltweit einsetzen. Und zum Abschluss, dass sie das Ganze auch auf jeden Fall verschlüsselt haben wollten, um die Daten gesichert im System zu haben.
Hat ja auch große Sicherheitsrelevanz, wenn ich weiß, wie viel wird da gewogen und wie viel wird wo hingeliefert – ist ja ein strategisches Geschäftsgeheimnis, das auf jeden Fall gut abgesichert sein muss. Thomas, du hast am Anfang DENIOS angesprochen – im Gefahrstoffumfeld gibt es ja noch ganz andere Herausforderungen, oder? Da hast du andere Normungen, vielleicht auch andere gesetzliche Vorgaben, die damit einhergehen – was war da euren Kunden wichtig?
Thomas
Richtig, Madeleine. Die Produkte, die wir dort entwickelt haben, die Hardware sollte ATEX-Zone-0-zertifiziert sein – das heißt, ein Gerät muss eigensicher betrieben werden können. ATEX Zone 0 bedeutet, 90 Minuten jeder Form von Gas – auch bei Defekten – ausgesetzt zu sein, ohne dass es zur Explosion kommt. Das ist eine hohe Herausforderung an die Konzeption der Hardware. In Gefahrstofflagern werden ja unterschiedlichste Dinge gelagert, und deswegen diese Herausforderung, die Hardware nach ATEX Zone 0 zu zertifizieren. Man kann sich vorstellen: Eine Applikation, die mit einem Modem, einer Spannungsversorgung betrieben wird, eigensicher zu machen nach ATEX Zone 0, das ist schon eine Herausforderung an die Ingenieure, die diese Hardware konzipieren.
ATEX Zone 0 ist eine Anforderung eures Kunden?
Thomas
Das ist eine Sicherheitsanforderung, prinzipiell ein weltweiter Standard.
Lösungen, Angebote und Services – Ein Blick auf die eingesetzten Technologien
Sven, ihr habt schon ein bisschen angeteasert: Ihr habt jetzt irgendwo ein intelligenteres System mit einer ERP-Integration geschaffen, wo man diese Daten auch über eine Waage aufnimmt. Kannst du uns ein bisschen abholen, vielleicht von der Hardware in die Cloud – wie funktioniert eure Lösung? Was habt ihr genau gebaut?
Sven
Wir haben ein Waagensystem entwickelt; der Produktname heißt iSCALE. Darunter wird das bei Würth auch tatsächlich im Markt vertrieben und ist jetzt in der Serie und beim ersten Kunden im Einsatz. Das ist ein vollautomatisiertes Kanban-System. Das heißt, in der Produktion beim Kunden, am Montageplatz beim Kunden stehen die Kanban-Behälter in wie so einem Regal. Das war in der Vergangenheit schon so. Bis dato aber so, dass immer zwei Kanban-Behälter hintereinander gelagert werden. Sobald der erste leer ist, wird der oben auf das System gestellt, der zweite rutscht nach vorne – und wenn der Würth-Mitarbeiter, hoffentlich, pünktlich vorbeikommt, wird das leere Behältnis wieder aufgefüllt und wieder hinten einsortiert.
Das heißt, zum einen ein rein manueller Prozess und zwei Behälter hintereinander, was eine gewisse Tiefe des Systems mit sich gebracht hat.
Wir haben jetzt eine Waage entwickelt, auf der jeder einzelne Kanban-Behälter steht. Das heißt, jeder einzelne hat eine eigene Waage, hat eine eigene batteriebetriebene Stromversorgung und ein eigenes Funkmodul. Also nicht das ganze System sendet einmal über ein Modul, sondern jede einzelne Waage sendet ihre Daten über unsere Cloud an das ERP von Würth. Somit haben wir eine optimale Redundanz, aber auch eine maximale Unabhängigkeit von der Situation beim Endkunden von Würth. Das heißt, wir brauchen keinen Stromanschluss, wir brauchen keine Verbindung zum Beispiel zum WLAN – was unserer Erfahrung nach häufig der wichtigste Grund ist, warum Dinge nicht gut funktionieren: Ich muss mit der IT beim Kunden sprechen, ich brauche Zugangsdaten; was passiert, wenn sich Konfigurationen beim Kunden ändern?
Das heißt, es funktioniert wirklich komplett autonom, und Würth hat eine große Sicherheit, immer Zugriff auf die Daten zu haben und somit zu wissen – über die Wiegefunktion und die Übermittlung der Daten ans ERP –, in welcher Geschwindigkeit nehmen die Teile ab und wann muss ich vor Ort wieder für neue Teile in diesem Behältnis sorgen? Diesen Prozess haben wir vereinfacht.
Und der zweite Vorteil, der sich in der Praxis auch als relevant herausgestellt hat, ist: Ich habe nur noch EINEN Behälter pro Teil. Das heißt, ich brauche diese Tiefe nicht mehr – das System ist nur noch halb so groß in etwa, halb so tief wie das ursprüngliche. Das ist bei Platzknappheit ein relevanter Wettbewerbsvorteil für dieses System.
Wenn wir das mal so ein bisschen von unten nach oben verstehen, also von der Hardware über die Datenverarbeitung in die Cloud – Thomas, wie geht das mit diesen Wiegesensoren genau? Wie muss man sich das vorstellen, von der Datenaufnahme bis zur Verarbeitung; wie sieht dieser Weg aus?
Thomas
Das ist ganz wenig kompliziert in diesem Kontext. Wir müssen ja hier nicht auf Gramm-Ebene wiegen. Sondern wir müssen eigentlich nur wissen, ist das Behältnis voll? Ist es halbvoll oder kurz vor einem definierten Grenzwert? – Das heißt, wir haben eine relativ grobe Datenstruktur und müssen nicht auf Gramm-Ebene wiegen. Die Weiterverarbeitung der Daten ist in diesem Projekt insofern auch einfach, weil wir sie, nachdem wir sie vorverarbeitet haben – also wissen, welches Gerät von wo aus was sendet –, über eine API in das Kanban-System von Würth liefern. Das heißt, die Aufbereitung der Daten macht hier – anders als beim Kunden DENIOS – die Würth selber, in ihrem Kanban-System. Also wir müssen der Würth hier keine Softwareapplikation liefern – die haben sie schon. Sie bekommen von uns nur die Rohdaten geliefert, und wissen, mit diesen Daten umzugehen.
Und API ist einfach nur die standardisierte Schnittstelle, die ihr nutzt, um die Daten von A nach B zu routen?
Thomas
Ganz genau, so ist es. Das Interface quasi zwischen zwei unterschiedlichen Datensystemen.
Noch einen Schritt weiter geht es dann ums Gerätemanagement. Ihr hattet gesagt, das sind verschiedenste Behälter, die dort getrackt werden – wie funktioniert die Verwaltung der Geräte
Viktor
Gerätemanagement ist ein sehr wichtiger Bestandteil der IoT-Kette. Wie Sven vorhin gesagt hat: Jedes einzelne Gerät ist mit dieser Funktechnologie ausgestattet und das Ganze muss gemanagt werden. Das heißt, wir müssen wissen, von wem und wann diese Geräte diese Sachen liefern. Dafür gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Bei diesen beiden Use Cases gibt es zum Beispiel ein Keep-alive oder ein Heartbeat. Das heißt, diese Geräte setzen je nach Use Case – bei DENIOS zum Beispiel einmal die Woche, aber auch bei den Waagen bis zu stündlich – einen Keep-alive aus: Ein Lebenszeichen, dass sie überhaupt da sind. Und sie sind damit auch erreichbar, aus dem System heraus. Das Nächste bei dem Gerätemanagement: Ganz wichtig ist die Firmware-Update-Funktion. Alle diese Geräte beinhalten diese Funktion, um bei Änderungen in dem Betriebssystem auf den Geräten als auch in der Technologie mitzugehen. Das heißt, wenn weltweit sich Standards in der Funktechnologie ändern, können wir die Geräte noch dahingehend per Software updaten. Und wichtig ist auch noch, dass wir durch die bidirektionale Verbindung während des Keep-alives die Möglichkeit haben, die Geräte zu konfigurieren – also die verschiedenen Level der Gewichtsveränderungen beispielsweise zu adjustieren. Kleine Schraube – kleine Gewichtsveränderung; große Schraube – große Gewichtsveränderung. Das ist je nach Material unterschiedlich, und das ist dann auch ein wichtiger Aspekt – die Rückverfolgbarkeit der Konfiguration.
Im ERP sind die ganzen Aufträge von Würth beziehungsweise die C-Teile getrackt – wie funktioniert diese Integration da genau? Ihr liefert einfach ein Datenpaket in das ERP-System, wo das wieder zurückgespielt wird?
Viktor
Ja, im Wesentlichen ist das genau so richtig. Wir bereiten erst mal die Daten auf, bei uns im System, das heißt im Gerät. Wir setzen sie so zusammen, dass sie gut übertragbar sind, mit wenig Datenaufwand. Dann werden sie in der Middleware aufbereitet für das System des Kunden. Im Fall von Würth wird es über die API direkt an den Kunden weitergegeben, und dieser kümmert sich dann um die Nachverfolgbarkeit, um die Nachbestellung der Teile und so weiter. Bei anderen Kunden, wie DENIOS, müssen dann von unserem System aus Alarmsysteme losgehen. Dann beginnt bei UNS die Kette.
Middleware heißt im Endeffekt, dass ihr auf eine Serverstruktur oder Datenpower, Rechenpower zugreift, die beim Kunden läuft, um die Datenvorverarbeitung zu machen und die Daten weiterzugeben?
Viktor
Das ist teilweise richtig. Die Middleware läuft bei uns – das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil sie das Gerätemanagement mit versorgt und auch beinhaltet und wir uns um die Datenverbindung selber kümmern, die over-the-air passiert. Und der Kunde hat damit einfach erst mal nichts zu tun. Diese Middleware bereitet dann dem Kunden die Daten so weit auf, wie er sie benutzen möchte.
Thomas, du hast vorhin auch Regeln angesprochen – das heißt, ihr macht auch den Teil der Algorithmik mit. Vorhin fiel das Stichwort Machine Learning und so weiter. Das sind ja im Endeffekt Algorithmen, die laufen, um Regeln zu definieren. Du hast von Grenzwerten gesprochen – da geht ihr nun so weit, dass ihr diese Intelligenz auch in diese Systeme einbringt?
Thomas
Ja, völlig richtig. Wie gesagt, im Falle Würth ist die wesentliche Intelligenz im Kanban-System der Firma Würth selber. – Den meisten unserer Mittelstandskunden bieten wir diese Intelligenz in unserer Cloud. Das heißt, dort werden die definierten Regeln hinterlegt und dort werden prinzipiell die Daten analysiert, mit den Algorithmen, um dann Handlungsempfehlungen auszusprechen. Der einfachste Fall ist, nehmen wir mal eine Temperatur: Da sagen wir, Achtung, sieben Grad ist der Grenzwert unten, fünfzehn Grad ist der Grenzwert oben. Dann macht eigentlich unser System so lange nichts, wie innerhalb dieser Grenzwerte gearbeitet wird – und erst wenn ein Grenzwert über- oder unterschritten wird, gibt es eine Reaktion darauf. Aber wir können auch messen, wie häufig sind Grenzwertverletzungen? Gibt es etwas, das man daraus ableiten kann, um eine Handlungsempfehlung auszusprechen? Bei den meisten Kunden, die wir betreuen, liefern wir die gesamte Prozesskette. Wir sind aber auch, wie man bei Würth sieht, in der Lage, an jedem Teil der Kette anzusetzen – je nachdem, was der Kunde für einen Bedarf hat, würden wir die Leistung anpassen.
Wenn ich als Kunde spezifische Anforderungen an eine Hardware habe: Die produziert ihr ja auch selber mit der Muttergesellschaft, über die HK.SYSTEMS, oder?
Thomas
Das ist absolut korrekt. Hoffmann + Krippner ist schon seit 50 Jahren am Markt, familiengeführt. Heute ist in der Geschäftsführung Ralf Krippner, der sich schon sehr frühzeitig mit den Themen der Digitalisierung auseinandergesetzt hat, weil das Unternehmen aus dem Bereich der Eingabesysteme kommt – etwa Folientastatur, Touchscreens – und er dort früh in Richtung Datenübertragung die richtigen Fragen gestellt hat: Wie kann ich Werte denn noch intelligenter und zielführender nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu nutzen? Wir fertigen heute die iSCALE, die Würth-Waage in Buchen im Odenwald bei unser Muttergesellschaft Hoffmann + Krippner. Wir machen das aber auch mit dem SpillGuard, also dem DENIOS-Produkt. So können wir tatsächlich sagen, wir sind im Prinzip von der Entwicklung der Hardware über alle Prozessschritte bis hin zu Services und Operations für unsere Kunden der Ansprechpartner und liefern auch das Stück Hardware an den Kunden beziehungsweise an die Endkunden unserer Kunden.
Ich glaube, dass auch viele Interessenten noch ganz andere Projekte vor der Brust haben. Da geht es vielleicht nicht ums Wiegen oder um Gefahrstoffe oder Brandschutz. Sondern möglicherweise einen anderen Use Case, wo ich ebenfalls die Hardware brauche und die durchgestochene Kompetenz. Da würdet ihr sozusagen auch die Hardwareentwicklung mit übernehmen beziehungsweise die Kompetenz an der Stelle mitbringen?
Thomas
Sowohl die Hardwareentwicklung als auch – ganz wichtig – die Hardwareproduktion.
Ihr geht damit raus und sagt, ich entwickle in sechs Wochen mein IoT-Produkt – ist erst mal sehr gewagt. Wie mache ich das denn? Kannst du das Geheimnis auflösen: Wie entwickle ich mein eigenes IoT-Produkt mit euch zusammen in sechs Wochen?
Thomas
Die Aussage erschien uns zu Beginn, als wir sie uns auf die Fahne geschrieben haben, auch gewagt. Aber wir haben inzwischen glücklicherweise häufig bewiesen, dass das tatsächlich möglich ist. Die Projekte, die wir heute hier besprochen haben, sind alles solche Projekte. Und der erste Schritt, den wir immer gehen, ist, dass wir gemeinsam mit unserem Kunden ein Kick-off machen. Das hört sich jetzt total banal an … aber wir legen großen Wert darauf, dass wirklich die geballte Kompetenz aus beiden Bereichen am Tisch sitzt: Also sowohl von unserer Seite, über alle Prozessschritte hinweg, die für dieses Projekt beim Kunden von Bedeutung sind. Als auch – und davon versuchen wir auch unsere Kunden zu überzeugen – alle relevanten Know-how-Träger im Unternehmen des Kunden.
Ja, Stichwort Schnittstelle, hattest du am Anfang gesagt.
Thomas
Stichwort Schnittstelle, genau. Du hast das richtigerweise gerade noch mal angesprochen: Es geht nicht immer um Wiegen und es geht natürlich auch nicht immer um Gefahrstofferkennung. Sondern es geht darum, über Sensoren etwas aufzunehmen, die Daten zu übertragen, zu verarbeiten und sinnvoll auszuwerten oder anzureichern. Und DIESE komplette Prozesskette setzen wir auf Hardwaregrundlagen auf. Unsere Erfahrung ist, dass wir an der Hardware teilweise fast nichts mehr ändern müssen, weil sie einen gewissen Standard erreicht hat, den wir so einsetzen können. Siebzig Prozent, können wir fast garantieren, haben wir dort schon im Portfolio. Das heißt, wir setzen auf einem sehr, sehr hohen Level schon auf. Das Gleiche gilt auch für die Cloudlösung, wo wir die verschiedenen Prozesse heute schon abgebildet haben. Für andere Anwendungsszenarien nehmen wir vielleicht noch Anpassungen und Ergänzungen vor. Aber im Prinzip fängt der Kunde mit uns nicht bei null an, sondern, ich sage jetzt mal, im Durchschnitt vielleicht bei 70–75 Prozent. Das beschleunigt natürlich den gesamten Prozess; beschleunigt aber vor allem den Weg vom Start zum Proof of Concept. Und das ist so der erste wichtigste Meilenstein. Wir hatten ja vorhin bei den drei Top-3-Gründen unter anderem das Thema Angst vor dem Scheitern – es ist eben auch wichtig, konkrete Meilensteine zu setzen und zu sagen, das ist ein Erfolgserlebnis, das zu haben, und dann gehen wir den nächsten Schritt. Genau das erarbeiten wir gemeinsam mit dem Kunden in diesem Kick-off und halten das anschließend als Lastenheft fest.
Das heißt, ich komme in sechs Wochen zu meinem IoT-Produkt, man macht ein Kick-off, bringt alle Leute an den Tisch, die daran arbeiten und Wissen einbringen können. Dann setze ich auf eurem Know-how auf – das spart Zeit. Siebzig Prozent, sagtest du, ist schon da an Hardwarekompetenz, Portfolio. Und natürlich die Softwareapplikations-Kompetenz, die ihr mitbringt. Plus, dass ihr das vom Einkauf bis zur Produktion komplett betreut.
Thomas
Ich würde das gerne noch mal ergänzen: Im besten Fall kommt der Kunde mit seiner Vorstellung eines Business Cases zu uns. Dann ist es genau der Weg, den wir gerade beschrieben haben. Aber es gibt auch Kunden, die haben eine Idee, und wir müssen diese erst validieren. Denn am Ende des Tages ist es wichtig, dass es ein Businessmodell gibt. Wir führen die Technologie nicht der Technologie wegen ein, sondern weil wir damit etwas Gewinnbringendes erzeugen wollen. Dann ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht ganz vorne noch mal mit dem Kunden auch an einem Businessmodell arbeiten. Das können wir in den Workshops, die wir anbieten, erledigen.
Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices – So wird der Erfolg gemessen
Es steht und fällt immer mit dem Business Case – am Ende wollen wir damit wirklich Kosten einsparen oder Umsatz steigern. Ein neues Geschäftsmodell aufsetzen oder einfach, wie beschrieben, einen Service optimieren. Zusammengefasst, Sven, was ist der Business Case für Würth, ganz kompakt?
Sven
Der Business Case für Würth ist tatsächlich die Prozessoptimierung und die Attraktivität des Systems bei einem Kunden – wodurch natürlich neue Kunden und neue Systeme beim Kunden platziert werden können. Um vielleicht gerade hier noch mal den Schwenk zur DENIOS machen: DENIOS war bisher ein reiner Hardwarelieferant. Das heißt, die Detektion von Gefahrstoffen wurde als Stück Hardware verkauft. Mit dem DIGITALEN Produkt ist DENIOS jetzt in der Lage, das gar nicht mehr zwingend an den Kunden zu verkaufen, sondern – ähnliche wie man das zum Beispiel aus der Mobilfunkbranche kennt, das Handy wird subventioniert – das Stück Hardware wird beim Kunden günstig platziert. Und über die Laufzeit und Serviceentgelte lassen sich eine lange Kundenbeziehung und entsprechende Revenues realisieren.
Ich glaube, das ist der wichtige Punkt: den Business Case zu betrachten. Viele sind auf dem Weg oder bringen die ersten Ideen mit für Geschäftspotenziale. Und falls sie die Strategie noch nicht fertig haben, müssen diese dann verpackt werden.
Übertragbarkeit, Skalierung und Nächste Schritte – So könnt ihr diesen Use Case nutzen
Ich finde es immer spannend, über die Übertragbarkeit der Use Cases zu sprechen. Habt ihr denn noch andere Kunden oder Ideen, wo ihr sagt, im Laufe dieser Gespräche sind plötzlich noch diese und jene Sachen gefallen, oder der Kunde hat gesagt, »Mensch, das ist ja so ähnlich, können wir bei uns auch anwenden!« Habt ihr da so ein paar Best Practices, wie man diese Use Cases, die ihr vorgestellt habt, geschäftlich übertragen kann?
Thomas
Nehmen wir mal DENIOS, wo wir eben mit dem Leckage-Sensor angefangen hatten, der nichts weiter tun sollte, als sicherzustellen, dass die Gefahrstoffe nicht auslaufen. Mittlerweile haben wir da ganz viele unterschiedliche Projekte. Wir vernetzen jetzt deren Raumsysteme, bieten dazu kompletten Service. Ist die Tür des Gefahrstofflagers zu? Läuft die Klimaanlage? All die Informationen, die sich um das Thema Gefahrstoffe im Raumsystem abspielen. Davon ableitend kann man natürlich das Thema Gebäudemanagement beispielsweise nehmen. Das ist ja derselbe Use Case – sind alle Lampen heile? Ist das Licht an oder aus? Also man kann eigentlich mit ein bisschen Fantasie aus jedem IoT-Projekt weitere Ideen ableiten.
Nicht zuletzt hatten wir beispielsweise mal für die Firma Rastal einen intelligenten Bierdeckel entwickelt, der mit einem Bierglas kommuniziert – ich meine, das ist ja erst mal ganz weit weg von irgendwelchen IoT-Use-Cases, wenn man darüber nachdenkt. Wichtig ist, das betone ich hier noch mal, eine Betrachtung des Geschäftsmodell. Ansonsten ist jedes IoT-Projekt eine Totgeburt. Denn am Ende muss jede Firma die Rechnung bezahlen; der Aufwand muss sich irgendwo wiederfinden – entweder durch verbesserte Services oder durch Beschleunigung oder was auch immer. Das ist die wesentliche Thematik in dem Kontext.
Vollkommen, sonst haben wir einen Haufen technische Use Cases – aber irgendwer muss am Ende das bezahlen. Man will den Return dazu haben. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, das fehlende Know-how ist kein Problem – da gibt es die entsprechenden Expertisen, beispielsweise durch euch und die Partnerkonstellation, die ihr mitbringt. Das Thema Schnittstellen-Koordination ist etwas – gut, man muss die richtigen Leute an den Tisch holen; man braucht Input und Experten, um das Ganze zu entwickeln und gemeinsam anzugehen. Und dann aber auch die Angst vor dem Scheitern ein bisschen ablegen und einfach mal starten. Es gibt genügend spannende Beispiele, nicht nur bei uns in der Community, sondern auch woanders. Wo man einfach schauen kann: Was machen andere schon? Beobachten, welche Potenziale die Technologie, aber auch der Markt einfach mitbringt. Neue Kundenanforderungen aufnehmen. Enablen und Angehen! Ihr steht auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es in die Diskussion geht, oder?
Sven
Absolut. Jeder, der Fragen hat und mit uns diskutieren möchte, ist herzlich willkommen. Die Kontaktdaten findet ihr in der Community.